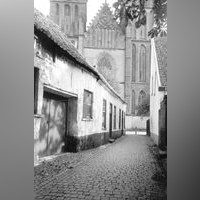Kleve. . Mit Errichtung der Schenkenschanz wurde Kleve zum Schauplatz einer der längsten kriegerischen Auseinandersetzungen im Westen Europas.
Herzog Wilhelm von Kleve war alles andere als erfreut. Als niederländische Soldaten im Mai 1586 damit begannen, vor den Toren der Stadt eine Schanze zu bauen, da sah Herzog Wilhelm die Probleme für Kleve schon heraufziehen. Seit fast 20 Jahren wurde in den angrenzenden Niederlanden ein erbitterter Freiheitskampf gefochten. Was 1568 mit vereinzelten Aufständen im Westen des Landes begann, entwickelte sich rasch zu einem geregelten Krieg über Nordwesteuropa. Zunehmend wirkte sich das Kriegsgeschehen auch auf die Klever Lande aus – doch mit dem Bau einer Festung im Rhein, an der damaligen Gabelung von Rhein und Waal bei Kleve, würde Wilhelms Territorium vollends zum Kriegsschauplatz der europäischen Mächte.
Wichtiger Beitrag zur Klever Hofhaltung
Herzog Wilhelm beschwerte sich. Er sah seine Hoheit für die Rheininsel Grevenward verletzt, auf der zwar nur wenige Bauern und Fischer lebten, die aber einen wichtigen Beitrag zur Klever Hofhaltung leisteten. Die niederländischen Generalstaaten hörten zwar den Protest, machten sich allerdings nicht viel aus dem Widerspruch des Herzogs: Zu wichtig war die strategische Bedeutung der Insel, als dass man auf die Kontrolle der wichtigen Flüsse Rhein und Waal verzichten wollte.
Im Mai 1586 bekam der Heerführer Martin Schenk von Nideggen also grünes Licht für den Bau einer Schanz. Schenk, der in Goch geboren wurde und im niederländischen Afferden seinen Familienbesitz Burg Bleyenbeek unterhielt, kannte sich gut aus am Niederrhein und war mit seinen herumziehenden Truppen in der Bevölkerung gefürchtet. Schenk war ein klassischer Heerführer der frühen Neuzeit: Er kämpfte für Geld, weniger für die Sache. Er bot eine militärische Dienstleistung an, die er sich gut bezahlen ließ: So stand er bis 1577 an der Seite der niederländischen Freiheitskämpfer, dann kämpfte er bis 1585 für die Spanier, danach schwor er wieder den Treueeid für die niederländischen Generalstaaten. Ungewöhnlich war dieses Wechselspiel für die damalige Zeit nicht.
Die Insel Gravenward
Der Graf von Leicester, Robert Dudley, Abgesandter der britischen Königin, hatte den militärisch sehr geschickten Martin Schenk 1585 wieder für die niederländische Seite begeistern können. Martin Schenk machte den Engländer, der die schwächelnden niederländischen Protestanten unterstützen sollte, auf die einmalige Lage der Gravenward im Rhein bei Kleve aufmerksam. Mit 1000 Soldaten soll Schenk die erste Festung errichtet haben. Biograf Karl Kossert schreibt, dass er mit „voller Härte“ die Bewohner der nahegelegenen Ortschaften zum Frondienst zwang. Auf Eigentumsverhältnisse wurde keine Rücksicht genommen: Die Burg Biesenberg wurde für ein freies Schussfeld abgerissen.
Wie die erste Schanz von Martin Schenk ausgesehen hat, ist heute nicht bekannt. Nach seinem Tod im Jahr 1589 wurde allerdings das Anwesen auf der Rheininsel Grevenward durch den Baumeister Adriaen Anthoniszoon aus Alkmaar zu einer richtigen Festung ausgebaut. Auch über das Aussehen dieser ersten Festung gibt es nur wenige Informationen. Sie soll sich auf 1100 Metern länglich in der Flussgabelung erstreckt haben und zu einer „halben Stadt“ mit Kirche, Schule und Marktplatz ausgebaut worden sein.
Kriegsschauplatz Kleve
Schenkenschanz, wie die Festung jetzt genannt wird, wurde zu einem der wichtigsten militärischen Stützpunkte der niederländischen Truppen. Wer sie besaß, der kontrollierte Rhein und Waal – die wichtigsten Lebensadern der Niederlande. Die Befürchtung des Klever Herzogs, dass sein Land zu einem wichtigen Kriegsschauplatz wird, sollte sich bestätigen. Denn die Schanz wurde in der Folge mehrmals von spanischen und niederländischen Truppen belagert.
So zog 1598 Admiral Mendoza mit 20.000 Soldaten über den Niederrhein und machte sich auf, die Festung zu erobern. Die niederländischen Truppen wurden von Prinz Moritz von Oranien, Sohn des Landesvaters Wilhelm von Oranien, angeführt. Im Februar 1599 versuchte Mendoza gemeinsam mit dem verbündeten Graf Frederik van den Bergh die Festung zu stürmen. Nach einer mehrtägigen Belagerung und schweren Verlusten auf beiden Seiten rückte das spanische Heer allerdings wieder ab.
Kleve war schlecht befestigt
Nach einem zwölfjährigen Waffenstillstand (1609 – 1621) standen sich die Heere von Prinz Moritz von Nassau-Oranien und des Marquis de Spinola 1621 erneut am Niederrhein gegenüber. Die Kriegswirren konzentrierten sich diesmal auf Emmerich und Wesel, aber auch aus Kleve flüchteten viele Menschen, weil die Stadt zu schlecht befestigt war. Aufgrund der unsicheren Lage wurde 1622 zwischenzeitlich die Klevische Regierung nach Emmerich verlegt.
1635 wurde die uneinnehmbare Festung Schenkenschanz dann doch von den Spaniern erobert. Adolf Eyndhouts war es gelungen, in der Nacht zum 28. Juli die Festung zu stürmen. Von zwei Seiten hatte er die Schanz angegriffen und innerhalb von zwei Stunden eingenommen. Für die Niederländer war dies eine Katastrophe. Schlagartig wurde der aktuelle Kriegsschauplatz von Brabant nach Kleve verlegt.
Der Prinz von Oranien, Friedrich Heinrich, zog noch am gleichen Tag ein Heer mit 4000 Musketieren nach Nimwegen, wo man sich zur Schlachtordnung formierte. Doch erst im April 1636 gelang es den Niederländern, ihre Schanz wieder einzunehmen. Denn die Spanier hatten das Umland schnell verstärkt. Der Spoykanal von Brienen nach Kleve war im August 1635 fest in spanischer Hand.
Schwere Verwüstungen
Die Kämpfe um Schenkenschanz hatten für Kleve verheerende Folgen. Nicht nur aus militärischer Sicht war die Lage kritisch, auch die Bevölkerung litt unter den Auseinandersetzungen. Dort, wo sich die Söldnertruppen gegenüberstanden, war an ein geregeltes Leben nicht zu denken. 1636 wurde Griethausen von niederländischen Truppen zerstört und auch die landwirtschaftlichen Flächen im Umland von Kleve waren verwüstet. Als der 80jährige Krieg zwischen den Niederlanden und Spanien mit dem Westfälischen Frieden 1648 beendet wurde, wies Kleve schwere Zerstörungen auf.